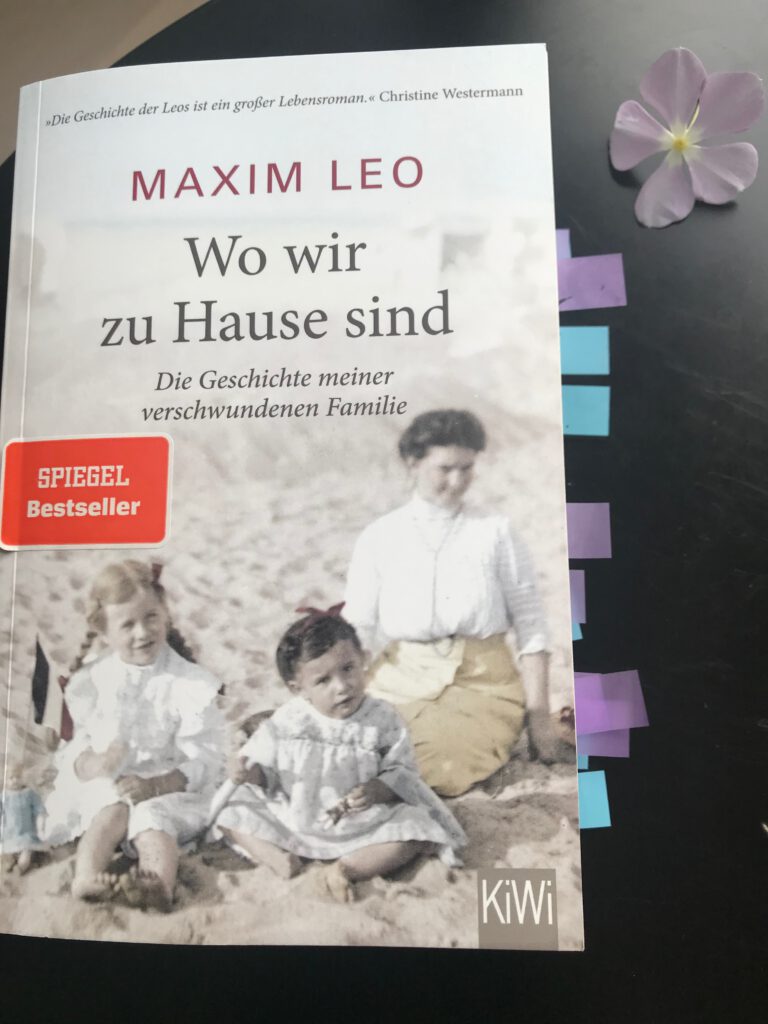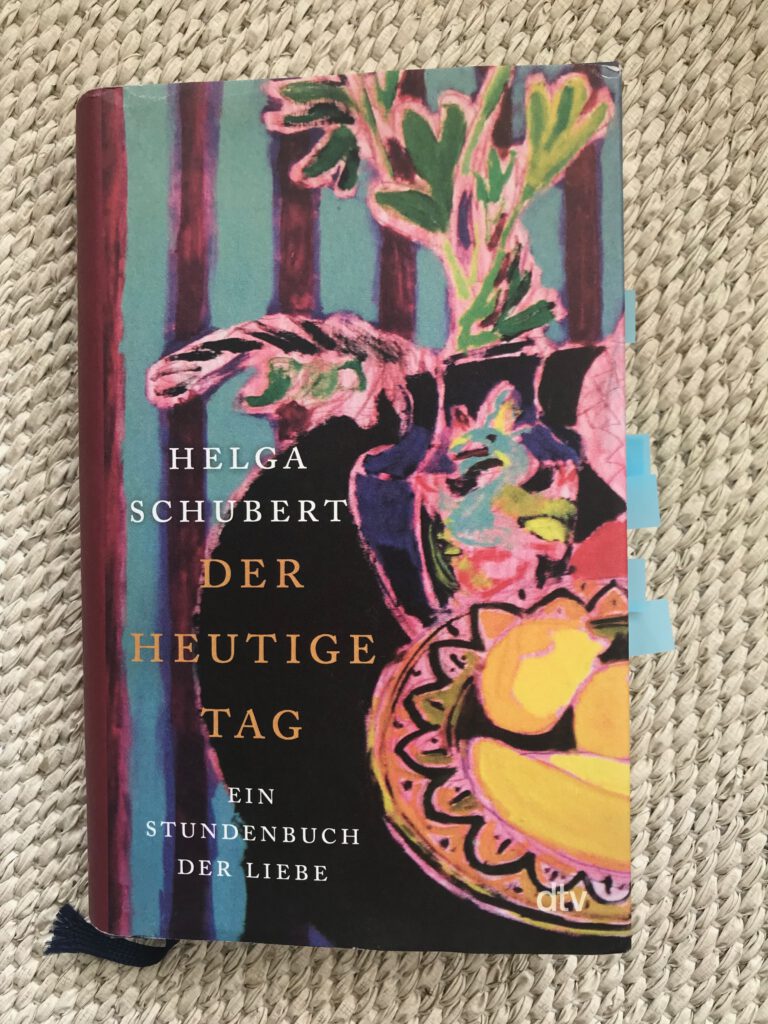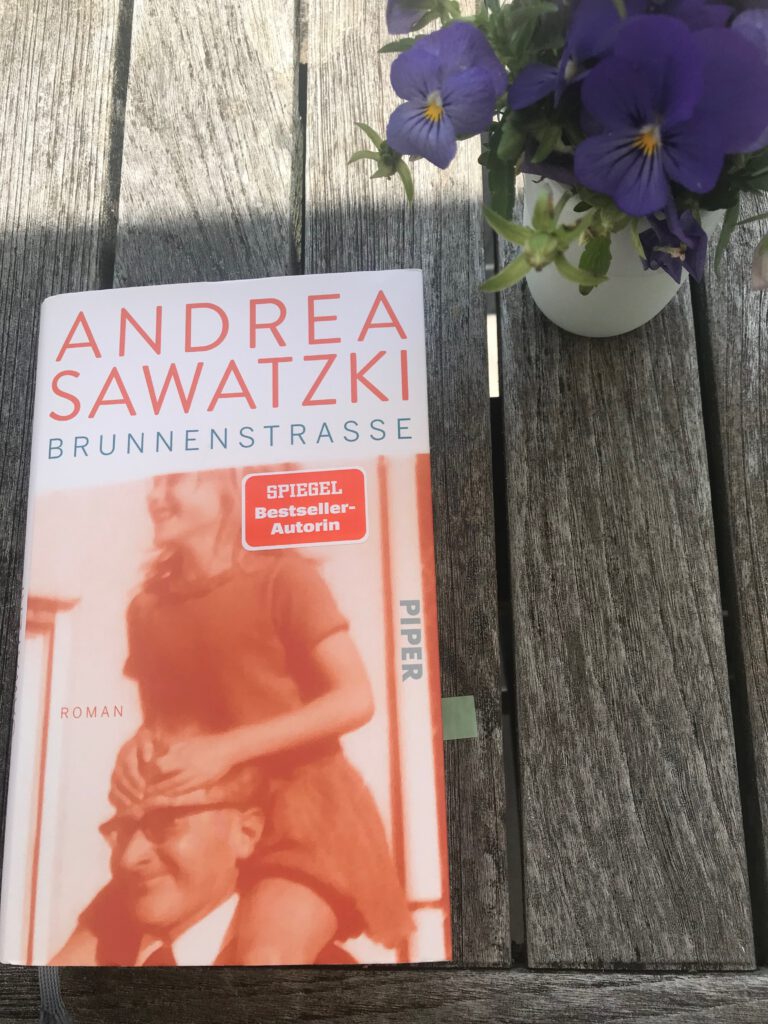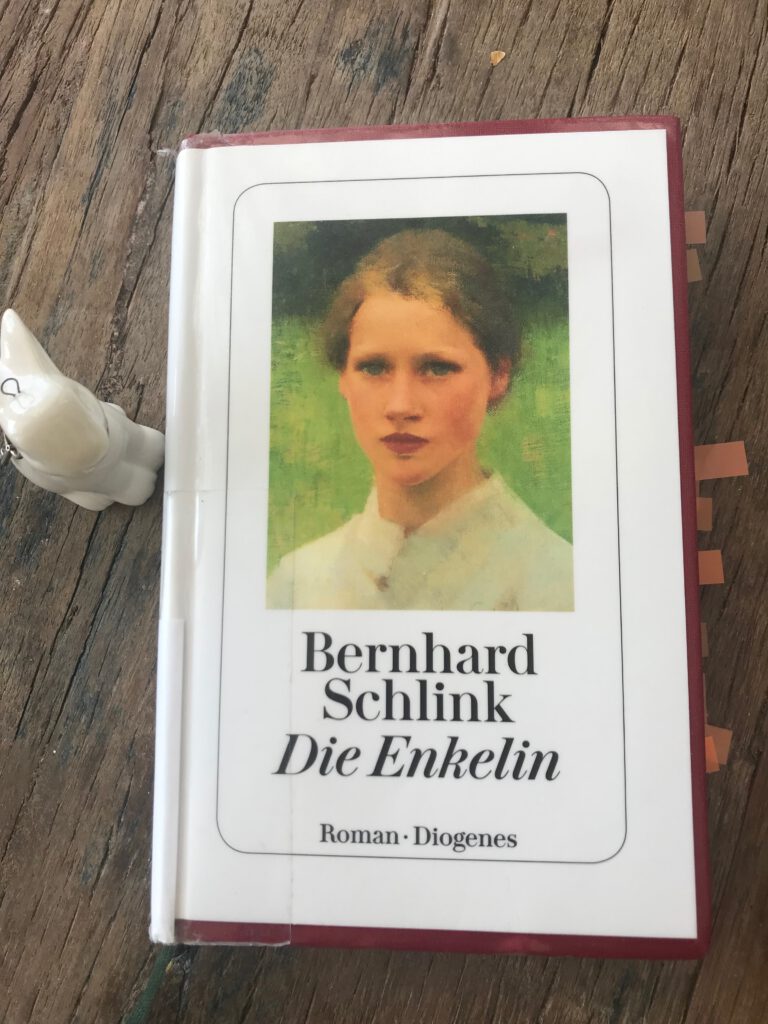Kernthema des Buches ist der Umgang zweier Freundinnen mit dem Älterwerden und seinen Begleiterscheinungen. Es dauert allerdings eine ganze Weile, bis das titelgebende Damenprogramm eine Rolle spielt im Buch. Zunächst wird ausführlich erzählt, wie das Leben der beiden Frauen Anna und Ruth bisher verlaufen ist. Und wo sie jetzt – nicht mehr jung, noch nicht „richtig“ alt – in ihrem Leben stehen. Anna hat vor kurzem ihren Mann verloren, Ruth beendet eine unbefriedigende Beziehung. Und Anna hat eine suchtkranke Tochter, was natürlich auch für ihr eigenes Leben eine ständige Herausforderung bedeutet und sich als weiteres Thema durch das Buch zieht.
Im Heute merken die beiden Frauen, wie das Alter unerbittlich näherrückt. … ein Grundrauschen, das wir je nach Tagesform deutlicher oder schwächer wahrnehmen. (…) Man wächst langsam, aber stetig aus dem Leben heraus. Aber die Freundinnen wollen sich dem nicht einfach ergeben. Das Leben hört doch erst auf, wenn es wirklich aufhört, sagt Ruth und kündigt an, sich etwas Verrücktes auszudenken. Sehr einfühlsam, pointiert und mit einer guten Prise Humor beschreibt die Autorin, wie sich das Leben für die beiden Damen reiferen Alters anfühlt, wie sie mit Tiefschlägen umgehen, aber den Kopf immer oben behalten, Ausschau halten nach für sie passenden Lebensformen und nach Trost und Halt. Wir schauen uns um in unserer Peergroup und stellen erfreut fest, wir sind nicht etwa allein.
Erst weit nach der Hälfte des Buches kommt die wohlhabende Ruth dann mit der Idee für das Damenprogramm – das ist eine Art Aufenthaltstipendium zum Thema Wie geht Altern? Was stößt einem zu, wenn man in die sogenannten Jahre kommt, und vor allem, was fangen wir damit an? Das hört sich spannend an. Die eintrudelnden Bewerbungen fürs Stipendium lesen sich höchst vergnüglich. Doch dann endet das Buch, allerdings mit F.f. Das lässt mich hoffen, dass es eine Fortsetzung gibt, denn wie sich das Damenprogramm entwickelt, das möchte man doch wirklich gerne wissen. Klare Leseempfehlung!