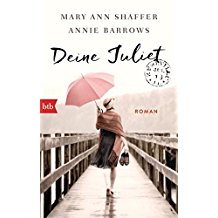Ich habe „Die stillen Tage“ von Zsuzsa Bánk geliebt und war sehr gespannt auf ihren neuen Roman. Ich mochte ihren poetischen Schreibstil, ihre wunderbaren Wortschöpfungen sowie die Stimmung, die sie zu erzeugen vermag – und ihre ungewöhnlichen Figuren. Aber bei der Lektüre von „Schlafen w erden wir später“ war ich lange unschlüssig – bewundere ich ihren noch manierierteren, noch elegischeren Sprachstil – oder lehne ich ihn ab? Gefällt mir dieses Buch? Zunächst ein klares „Jein“.
erden wir später“ war ich lange unschlüssig – bewundere ich ihren noch manierierteren, noch elegischeren Sprachstil – oder lehne ich ihn ab? Gefällt mir dieses Buch? Zunächst ein klares „Jein“.
Die Idee ist gut: Ein E-Mail-Wechsel zwischen zwei knapp vierzigjährigen Frauen, die sich gegenseitig um das beneiden, was die andere hat. Martá hat drei kleine Kinder, einen unzuverlässigen Mann und wohnt in der lauten und schmutzigen Stadt Frankfurt; Johanna wurde vor kurzem von ihrem Freund verlassen, sie ist kinderlos und lebt im Schwarzwald. Sie hat gerade eine Brustkrebserkrankung überstanden und kämpft sich durch ihren Alltag als Lehrerin, nebenbei promoviert sie über Annette von Droste-Hülshoff.
Martá wünscht sich nur eins: Zeit und Muße zum Schreiben. Der Alltag mit drei kleinen Kindern und ständige finanzielle Sorgen verhindern das gründlich, und es gibt so gut wie keinen Briefwechsel, in dem sie nicht ausgiebig über ihre Situation jammert. Das Motiv ist bekannt aus der Literatur: Eine durch das Klein-Klein eines zermürbenden Alltags verhinderte Schriftstellerin. Johanna wiederum beklagt ihr Verlassensein, beneidet die Freundin um die Familie und rät ihr immer wieder aufs neue, sich an den süßen Kleinen zu erfreuen. Aber Martá gelingt das nur in wenigen Momenten. (Warum hat sie drei Kinder?) So ist der Ton des Briefwechsels überwiegend weinerlich, trieft stellenweise geradezu vor Selbstmitleid. Ungefähr auf Seite 100 war ich echt bedient.
Dennoch bin ich dran geblieben. Die innige Beziehung der beiden Frauen, dieser grundehrliche Austausch über Befindlichkeiten, das Sinnieren über die Vergänglichkeit des Lebens, das Feiern der Freundschaft – es hat auch etwas Kraftvolles, Tröstendes und auf Dauer immer Vertrauteres. Man taucht tief ein in diese Intimität zwischen Martá und Jo und freut sich mit den beiden, dass sie (wenigstens) sich haben. Jede Frau, die sich glücklich schätzt, eine solch enge Freundin zu haben, wird wissen, was ich meine. Und dass der Alltag oft mühsam ist und der Blick für all das Schöne im Leben ab und an verstellt ist, wer kennt das nicht. Also warum nicht darüber schreiben? Nach diesen Erkenntnissen habe ich gerne weiter gelesen. Und es wird immer besser!
Was aber stört: Der Schreibstil der beiden Frauen unterscheidet sich nicht voneinander. Es dominiert der Zsuzsa Bánk Stil: Blumige Wortschöpfungen, aufeinander getürmte Adjektive, dreimalige Wiederholungen als wiederkehrendes Stilmittel bei beiden Schreiberinnen – man liest sich zwar ein und es ist sprachlich Schönes und kühn Kreatives darin, aber dennoch ist es für mich oft ein bisschen zu viel. Zu viel Klage, zu viel Weinerliches, zu viel Drama.
Mein Résumée: Wenn man sich darauf einlässt, dass (fast) nichts passiert (was ja grundsätzlich nicht schlecht sein muss), Freude an Bánks phantasievollem Schreibstil hat und durch eigene Erfahrungen sowohl die Klagen der beiden Frauen als auch die Intensität ihrer Freundschaft nachvollziehen kann, für den ist es eine lohnenswerte Lektüre. Die mit Sicherheit lange nachklingt.