Was für ein Buch! Genauso sehr wie der Inhalt beschäftigen mich viele Fragen: Hätte ich dieses Buch auch gelesen, wenn Toni Morrison nicht den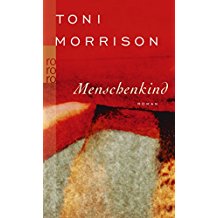 Pulitzer-Preis dafür bekommen hätte, wenn es nicht von einer Nobelpreisträgerin geschrieben worden wäre? Warum habe ich mich so schwer damit getan – zumindest phasenweise? Will ich mich nicht mehr anstrengen? Bin ich zu ungeduldig? Liegt es am Mystischen?
Pulitzer-Preis dafür bekommen hätte, wenn es nicht von einer Nobelpreisträgerin geschrieben worden wäre? Warum habe ich mich so schwer damit getan – zumindest phasenweise? Will ich mich nicht mehr anstrengen? Bin ich zu ungeduldig? Liegt es am Mystischen?
Die Geschichte erzählt von der ehemaligen Sklavin Sethe, die sich, hochschwanger, aus der Gefangenschaft befreien kann, und mit ihren drei bzw. vier Kindern bei ihrer Schwiegermutter unterkommt. Als die Geschichte einsetzt, lebt sie nur noch mit einem Kind zusammen. Ihre beiden halbwüchsigen Söhne sind auf und davon, ihre kleine Tochter lebt nicht mehr. Ihren Tod kann Sethe nicht verwinden. Der Geist des kleinen Mädchens spukt in ihrem Haus.
Morrison entrollt langsam, in vielen Rückblenden, Sethes langen Leidensweg. Dabei beschreibt sie nicht nur die von den Sklaven tagtäglich erlittenen Grausamkeiten, sondern führt eindringlich vor Augen, wie sich der Verlust der Freiheit für diese Menschen anfühlt. Sie schreibt so, dass einem permanent Bilder vor Augen kommen (ich musste häufig an den Film „Die Farbe Lila“ denken), man hört die Geräusche und Gesänge, hat die Gerüche in der Nase. Morrison schreibt poetisch, zart und gleichsam schwingend auf der einen Seite, aber auch zupackend und mit unerbittlicher Härte und Genauigkeit auf der anderen. Gleichzeitig lässt sie vieles in der Schwebe und nicht alles Verwirrende löst sich auf. Im Netz gibt es den Tipp, das Buch zweimal zu lesen, um es besser zu verstehen – aber auch die Anmerkung, wer will so ein schwieriges Buch denn gleich zweimal hintereinander lesen …
Aber dennoch: Das Buch ist auf jeden Fall sehr sehr lesenswert, man sollte sich Zeit dafür nehmen! Und es ist ein Buch, das sich gut für einen Lesezirkel eignet, denn im Gespräch mit anderen durchdringt man die Geschichte bestimmt besser, und erfahrungsgemäß beschäftigen jeden Leser andere Aspekte.