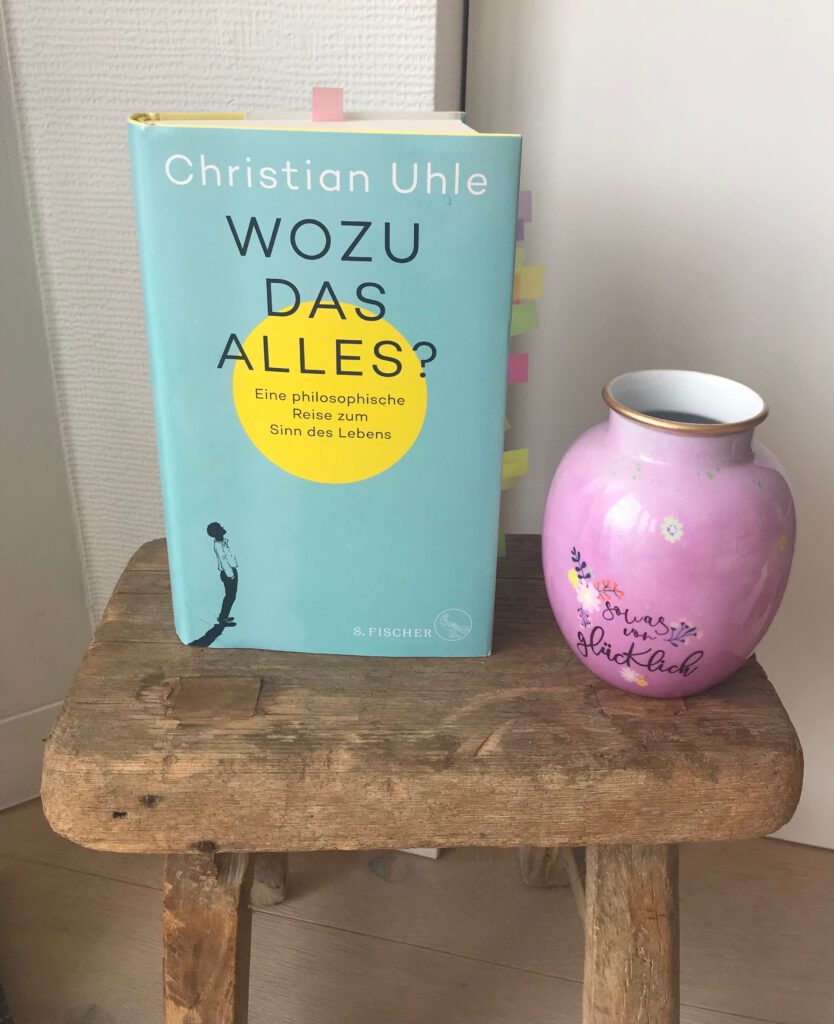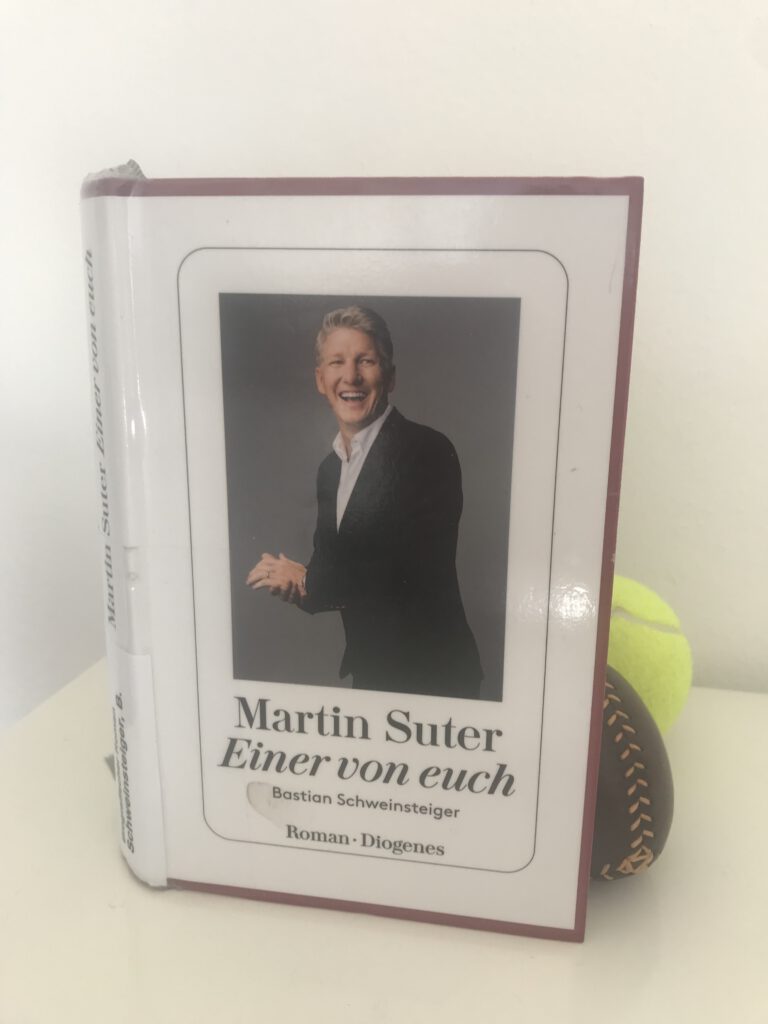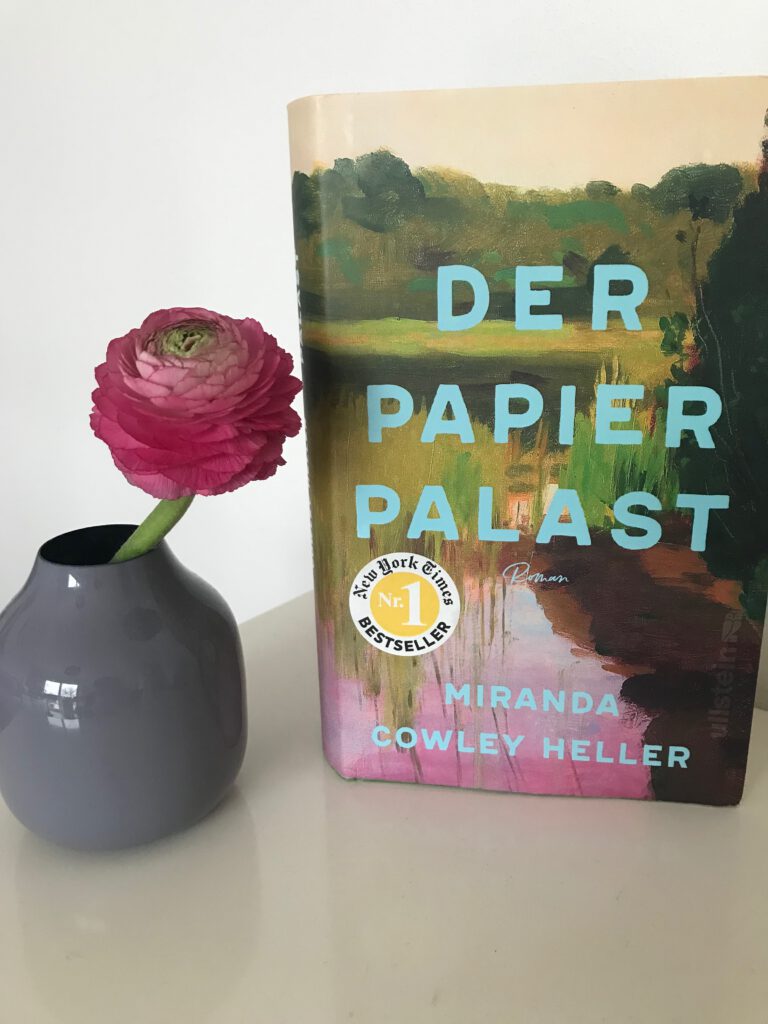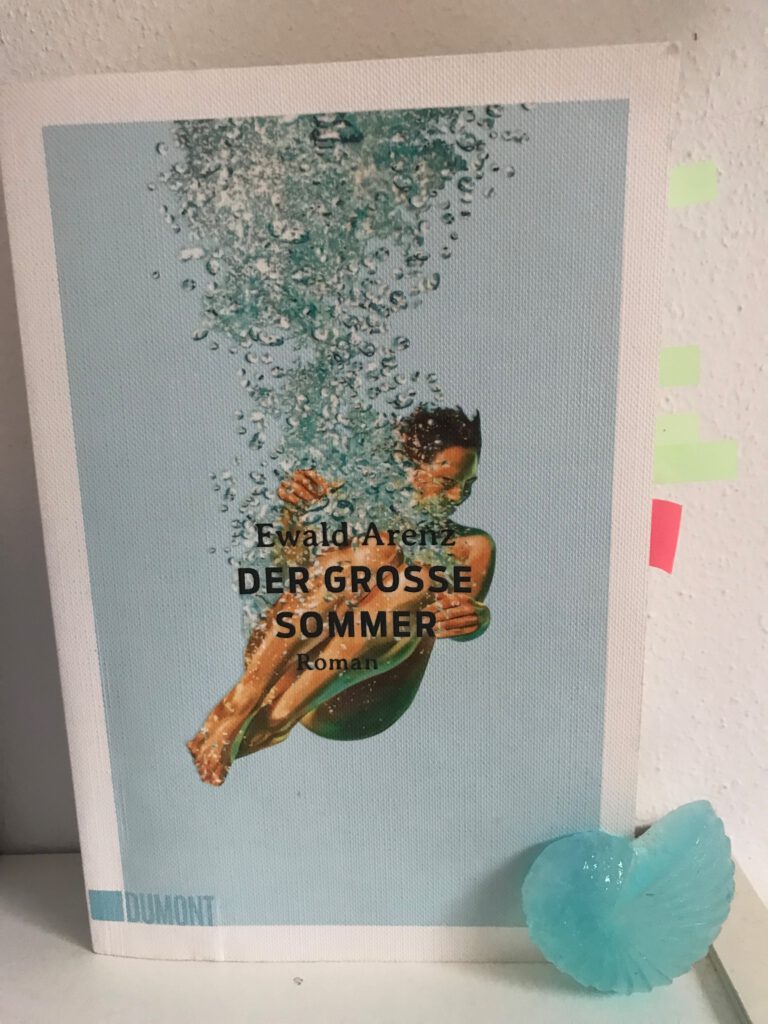Für Inselliebhaber und eingefleischte Meerfans ein Muss, und für alle Fans von Dörte Hansen auch!
War es bisher bei Hansen das Dorf, das langsam dem Wandel der Zeit zum Opfer fällt, so ist es hier das Leben auf der Insel, das sich unaufhaltsam ändert. Verdrängt werden die alteingesessenen Insulaner von den Fremden, die vom Inselleben träumen, Reetdach-Häuser erwerben, schick umkrempeln, und nach der ersten Begeisterung nur noch ab und an kommen. Und die sich nicht um alte Traditionen scheren. Und natürlich von den Touristen, die in Scharen mit den Fähren einfallen, so dass die Inselbewohner sich an die Tagesränder zurückziehen.
Im Mittelpunkt steht die Familie Sander, der das schönste Haus der Insel gehört, das Kapitänshaus – eine Touristenattraktion. Einen Kapitän gibt es aber nicht mehr in dem Haus, stattdessen zwei Erwachsene und drei Kinder, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, jeder geht seiner eigenen Wege. Auch der Inselpastor als weitere zentrale Figur trägt sein (Ehe-) Päckchen. Und mittendrin gibt es einen gestrandeten Wal, der vieles in Bewegung bringt, auch in der Familie Sander.
Schon nach wenigen Sätzen ist man auf dem Weg zu einer Nordseeinsel „irgendwo in Jütland, Friesland oder Zeeland“. Man spürt den heulenden Sturm, die salzige Seeluft, das Kopfsteinpflaster unter den Füßen, hört das Klappern der Pferdehufe. Gesprochen wird nicht viel in diesem Roman, Figuren werden nacheinander, erst namenlos, ins Geschehen geschoben. Und doch hat man sehr schnell ein genaues Bild von den Bewohnern und ist gefangen von dieser ganz besonderen Insel-Atmosphäre. Das ist die große Kunst der Dörte Hansen, uns mit wunderschönen, wohl gesetzten Worten, zu verzaubern. Das ist dieses Mal fragmentarischer als ihre anderen Romane, anfangs vermisste ich etwas die durchgehende Geschichte, aber es passt unglaublich gut zu dem, was sie erzählt. Beeindruckend und berührend.
Anmerkung zum Schauplatz: Angeblich hat Hansen die Insel gemischt, ein wenig Sylt, ein wenig Norderney, ein wenig Langeoog und ein wenig Amrum. Auf jeden Fall gibt es Autos auf der Insel. Und dennoch war ich im Geist durchgängig auf der autofreien Insel Spiekeroog. Ich kenne fast alle ost- und nordfriesischen Inseln, auf Spiekeroog spürt man noch am ehesten den Geist der alten Zeit, deshalb habe ich es wohl dort verortet.