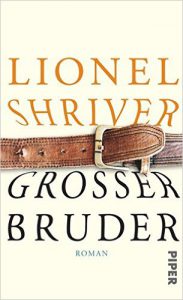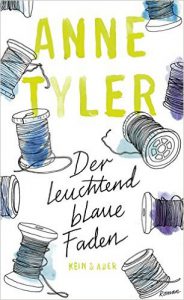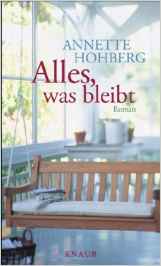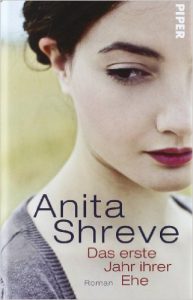Wieder ein gutes (aber nicht sehr gutes) Buch von Lionel Shriver, einer fantastischen Schriftstellerin mit provokanten Themen. Ihr bekanntester Titel „Wir müssen über Kevin reden“ ist genial. In „Großer Bruder“ geht es um das Thema Fettsucht, genauso aber auch um Magerwahn und Diätterror in all seinen Ausprägungen – also um unseren heutigen Umgang mit Ernährung. Aber es geht auch um die Frage, wie viel bin ich bereit zu opfern, um einem Familienmitglied zu helfen.
Die Ich-Erzählerin Pandora hat ihren großen, von ihr sehr verehrten Bruder Edison, lange nicht gesehen. Als er sich für einen Besuch bei ihrer Familie anmeldet und sie ihn am Flughafen abholt, erwischt es sie eiskalt: Er ist unfassbar in die Breite gegangen, wiegt über 150 kg! Diese Szene ist ganz großes Kino, ebenso das nachfolgende Zusammentreffen Edisons mit Pandoras Patchworkfamilie. Bald stellt sich heraus, dass das Übergewicht nicht Edisons einziges Problem ist, er hat jahrelang an seiner Lebenslüge des erfolgreichen Musikers gestrickt. Pandoras asketischer Ehemann Fletcher und Edison verhaken sich schnell und gründlich, auch ihr Stiefsohn ätzt gegen Edison, nur ihre Stieftochter sieht den Menschen in ihrem Onkel.
Shriver ist schonungslos ehrlich in ihren Beobachtungen und Darstellungen, das schätze ich so an ihr. Sie liebt überraschende Wendungen, das ist auch bei „Großer Bruder“ nicht anders. Dieses Mal hat sie mich aber nicht so überzeugt, weder mit der gesamten Geschichte noch mit dem Ende. Dennoch ist es ein lesenswertes Buch.
Ihr Bruder ist durch Fettleibigkeit zu Tode gekommen, das hat sie zu diesem Thema inspiriert. In einem Interview erklärt sie, wie viel Autobiografisches die Geschichte enthält. http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/neuer-roman-interview-mit-lionel-shriver-12870469.html