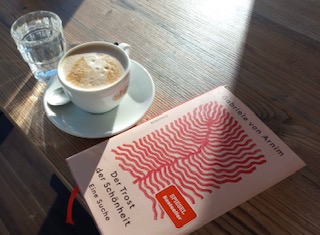Dieser kleine Roman ist ein Juwel. The Times zählt ihn zu den 50 wichtigsten Romanen des 21. Jahrhunderts. Zeitlich einordnen kann man die Erzählung in die 60iger Jahre des vorigen Jahrhunderts, denn es ist die Rede von der EWG und Butterbergen.
Ein Mädchen, acht oder neun Jahre alt, erzählt seine Geschichte. Es wird von seinem Vater bei entfernten Verwandten in Irland abgeliefert, wortlos, lieblos. Die Mutter erwartet schon wieder ein Kind und da kommt es den Eltern gerade recht, dass ein Maul weniger zu stopfen ist. Wir erleben mit dem Mädchen, wie seltsam sich diese fremde Umgebung bei den Verwandten anfühlt. Zu Beginn ist das Kind ständig in Sorge, es könnte etwas falsch machen, sich Unmut zuziehen. Aber zunehmend genießt es die wohltuende Zuwendung, die Geborgenheit und Leichtigkeit. Als Leser atmet man auf, freut sich mit dem Kind über den geordneten Alltag auf der Farm, auch wenn ein sorgsam gehütetes Geheimnis ans Licht kommt und einen Schatten auf diese leuchtenden Tage wirft.
Das ist in sehr sparsamen, fast kargen Worten geschildert. Aber zwischen den Zeilen passiert sehr viel; auch leiseste Schwingungen zwischen den drei Menschen auf der Farm sind zu spüren, und die Erfahrungen des Mädchens berühren einen auf eine unglaublich intensive Art und Weise. Und sie öffnen den Blick weit über das Schicksal dieses Kindes hinaus, erzählen etwas über den Wert von (Herzens-)Bildung und die Bedeutung elterlicher Fürsorge.
Aber, Achtung Spoiler:
Dieser Aufenthalt ist nicht von Dauer. Am Ende des Sommers, als die Schule wieder beginnt, wird das Mädchen zurückgebracht zu seiner Familie, zurück in sein karges Leben. Aber es hat sich etwas verändert.
Das Buch wurde unter dem Titel The quiet girl verfilmt.