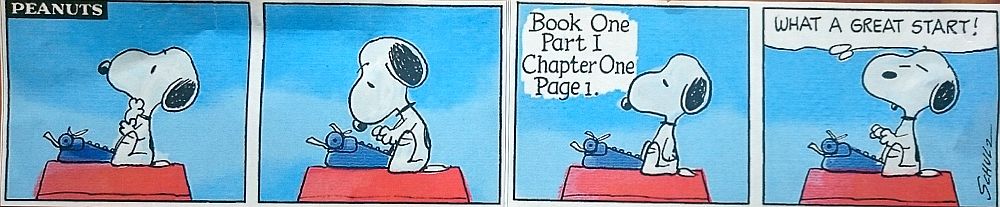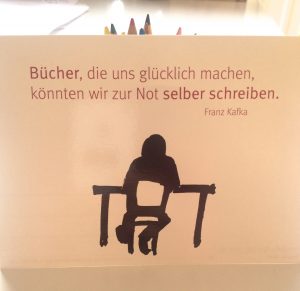Kapitel 9: Professionalität muss sein oder von Hurenkindern und Schusterjungen
Die Lektorin hat nicht nur (erschreckend viele) Fehler korrigiert, sie hat mir vor allem Mut gemacht, die Hauptperson im Roman mehr Gefühle zeigen zu lassen. Davor hatte ich mich immer gescheut, zum einen aus Angst, kitschig zu werden, und zum anderen kam mir in die Quere, dass die Protagonistin zwar Ähnlichkeiten mit mir hat, aber keineswegs mit mir identisch ist. Beim Durchlesen und Prüfen des Manuskriptes habe ich Stellen, an denen ich Zweifel hatte, immer rot markiert. Und nun war es ein erhebendes Gefühl, diese roten Stellen nach und nach aufzulösen. Wobei es auch manchmal echt schwierig war, sich für eine endgültige Variante zu entscheiden und die anderen (natürlich auch tollen;-) ) Formulierungen ins Nirwana zu schicken. Dieses Gefühl, auf die endgültige Fassung hinzutreiben – es war wunderbar und wehmütig zugleich – eine Achterbahn!
Es kam der Tag, an dem ich das Manuskript für fertig erklärt habe. Ein großer Tag! Aber ein Manuskript ist noch lange kein Buch und ein Buch will auch gelesen werden …
Es galt nun, sich um den Satz des Innenteils zu kümmern. Das bedeutete, eine Formatvorlage zu erstellen – also Satzspiegel, Schriftart, Laufweite und Durchschuss der Schrift zu bestimmen. Und dann Seite für Seite durchzugehen und unschöne Trennungen zu beseitigen und Hurenkinder und Schusterjungen (einzelne Zeilen eines Absatzes am Seitenende oder –anfang) auszumerzen. Und sich Gedanken über das Cover zu machen. Letzteres war leicht. Mein Mann hatte kürzlich ein geniales Foto gemacht – eins unter vielen, aber dieses gefiel mir besonders gut und es passte inhaltlich prima zur Geschichte. Was soll ich sagen: Das Ding ist jetzt in Druck, jetzt heißt es warten und Luft anhalten! In der nächsten, der letzten, Folge werde ich euch das fertige „Werk“ präsentieren.